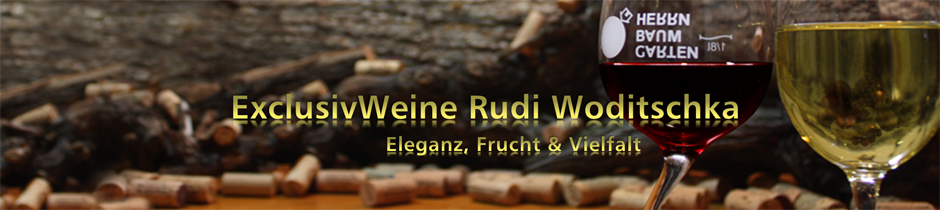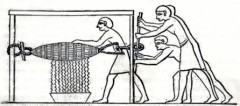Weinfacts
Jeden Tag bei der Heimfahrt meines Praktikums im Bundesamt für Weinbau schreibe ich kurze bis längere, brisante bis bekannte, neu erforschte bis grundlegende Weinfacts in Facebook. Zum Thema „enthält Sulfite“, dem Weinskandal, Kirchenfenster im Weinglas oder dem Gärgas gibt es ebenso interessante Infos, wie zum Hintergrund warum ein Rotwein grau wird, wenn man das Weinglas mit Wasser ausspült.
Damit ihr auch ohne Facebook-Profil mitlesen könnt, aktualisiere ich hier jedes Wochenende die Facts der vergangenen Woche.
Viel Spaß und Aha's.
Woche 1
#1 Warum wird ein Rotwein beim Glasauschwaschen plötzlich grau? Der Farbstoff der blauen Trauben, die Anthocyane, wirkt wie ein pH-Indikator. Es ist also die Anhebung aus dem weintypischen pH-Bereich 2,8-4 ins neutrale Wasser mit pH 7 schuld. Das ist übrigens auch der Grund warum die Trauben blau bzw. schwarz sind - erst wenn die Beerenschale mit dem sauren Saft aus dem Fruchtfleisch in Berührung kommt, wirds rötlich.
#2 Das Messsystem Klosterneuburger Mostwaage(KMW) beschreibt hauptsächlich den Zucker im Most(aber auch noch den Säure- und Extraktgehalt) und hat
meist einen Wert zwischen 15 und 22.
Pro KMW ist ca. 10g Zucker pro Liter Most enthalten, welcher bei der Gärung in Alkohol umgewandelt wird.
Um ein Prozent Alkohol im Wein zu bekommen, müssen 1,6 KMW von der Hefe umgewandelt werden.
Es hat also ein 20 Grad KMW Most einen Zuckergehalt von ~200g und könnte später einmal 12,5% Alkohol haben.
#3 Österreich hat als Folge des Weinskandals im Jahr 1985 das strengste Weingesetz der Welt. Die wichtigste Aussage
davon: dem Wein dürfen keinerlei Stoffe zugesetzt werden und keine Verarbeitungsmethoden angewendet werden, außer sie wurden explizit genehmigt(nach penibelster Analyse in allen Facetten der
Bundesregierung).
Damit kann der Kunde durch die kurzen Kontrollintervallen der eigenen "Weinbaupolizei" (Kellereiinspektion) sichergehen, dass sein Lieblingsprodukt eine reine Sache ist.
#4 Von den 45.000 Hektar Weingärten in Österreich sind genau zwei Drittel Weißwein-
und ein Drittel Rotweinsorten.
Wir haben 20.000 Weinbaubetriebe, wovon ein Drittel Weine in Flaschen abfüllt(im weltweiten Vergleich ein außerordentlich hoher Prozentsatz).
Insgesamt werden pro Jahr 250 Millionen Liter Wein hier erzeugt und als Besonderheit wird ebenso dieselbe Menge getrunken. Da 67 Millionen Liter exportiert werden, wird gleichviel für Weintrinker mit
internationalen Vorlieben importiert.
#5 Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts wurden Weinreben
fortgepflanzt bzw. vermehrt indem man einen langen Ast ein paar cm durch die Erde legte und den Rest weiter Richtung Sonne stehen ließ. Die Rebe hat an der Stelle im Boden Wurzeln gebildet und konnte
dann von der Mutterrebe abgeschnitten werden und eigenständig wachsen. Wenn die Wurzeln stark genug waren, konnte man die Pflanze ausgraben und umsetzen. Warum das seit dem 20. Jahrhundert absolut
nicht mehr gemacht wird, erklär ich am Montag.
Woche 2
#6 Mit Einschleppung der amerikanischen Reblaus, welche als Hauptnahrung Rebenwurzeln hat, gegen Ende des 19. Jhdts wurden in ganz Europa nahezu alle Weingärten zerstört und unser Weinbau schien am Ende. Als man herausfand, dass amerikanische Reben(heute als Uhudler-Sorten bekannt) gegen den Reblausbefall immun waren, jedoch deren Weine nicht schmeckten(Fox-Ton), wurde die seit der Antike bekannte Kunst der „Veredelung“ angewandt und somit amerikanische Wurzeln mit heimischen Sorten verbunden.
#7 Die Hefe von einem Liter Most erzeugt während der Gärung ungefähr 55 Liter Kohlendioxid - man könnte also mit 4
Liter Most eine Badewanne mit CO2 füllen.
Außerdem hat die Hefe in Spitzenzeiten im immer noch selben Liter Most ganze 17m² Hefezellwandoberfläche - mit 6 Liter könnte somit eine 100m² Wohnung mit Hefezellwänden bedeckt
sein.
#8 In Europa gibt es zwei komplett verschiedene Weinkulturen. Das romanisches System(FR, ESP, IT) und das germanisches System(GER, AUT, CZ, H). Beim romanischen wird am Etikett ein Gebiet angegeben(z.b. Chianti, Bordeaux) und in jedem Gebiet wurden der Weinsortenmix und die Verarbeitung festgelegt damit für den Kunden der Weintypus immer ähnlich und erkennbar ist. Beim germanischen System steht eine Sorte auf der Flasche und jeder Winzer bestimmt selbst wie er den Wein machen möchte.
#9 Mit dem DAC-System wurde versucht, die Vorteile des romanischen Weinkonzepts ins germanische zu packen. Die Erzeugung der gebietsbezogenen und somit weltweit einzigartigen und unkopierbaren Weine wurde 2004 mit dem Weinviertel DAC begonnen und zählt bis heute 7 verschiedene DAC-Gebiete. DAC steht übrigens für "Districtus Austriae Controllatus" und bedeutet Kontrolliertes bzw. Geschütztes Österr. Herkunftsgebiet, also der typische Wein einer Region mit spezieller Qualitätskontrolle.
#10 Nach genauer
Analyse von Weinbewertungen hat man herausgefunden, dass die ersten paar Weine einer Verkostung immer grundsätzlich schlechter bewertet werden, als Weine im Mittelfeld oder jene zum Schluss. Die
Koster sind noch zu vorsichtig und überkritisch. Deswegen werden diese meist mittendrin wiederholt und nur das zweite Ergebnis gezählt. Schlussweine weisen eine etwas höhere Bewertungsdifferenz(
wegen Müdigkeit & Alkoholwirkung) auf, das Ergebnis ist aber nur wenig verfälscht.
Woche 3
#11 Die vier Grundkonzepte zur Weinproduktion:
1. Die konventionenelle, industrialisierte Produktion - keine Vorgaben zu Naturschutz und Nachhaltigkeit(außer gesetzliche).
2. Die integrierte Produktion("IP-Betrieb") - Teile aus dem BIO-Konzept, jedoch einige Ausnahmen zur Risikominimierung
3. Das bekannte BIO-Konzept(keine künstlichen Spritzmittel, Gefahr der Schädlingsförderung)
4. BIO-dynamisch: Bio mit Esoterik(Dünger im Uhrzeigersinn anrühren und in Stierhörner im Weingarten eingraben)
#12 Die Weinrebe ist eig. eine Ranken- und Lianenpflanze, welche sich unkontrolliert an allem festkrallt. Sie wird von den Winzern im wahrsten Sinne des Wortes "erzogen", so zu wachsen, wie sie es brauchen. Wenn man sie ließe, würden alle Äste gerade in den Himmel wachsen. Man schneidet, kürzt, biegt sie zurecht und bindet sie an, damit es im Gesamten ein funktionierendes Weingartensystem wird, bei dem die Pflanze nicht unnötig Energien verschwendet und diese optimal in die Traube investiert.
#13 Beim weltweit berühmten Weinskandal im Jahr 1985 mischten einige Winzer Diethylenglycol(also Frostschutzmittel) in den Wein, da er dadurch süßlicher, vollmundiger und aromatischer schmeckte. Man konnte so einen schwachen Wein zu etwas Hochwertigem machen. Giftig wären selbst große Mengen eines solchen gepanschten Weines nicht gewesen. Aufgedeckt wurde dies, weil ein Winzer mit kleinem Traktor riesige Mengen Frostschutzmittel von der Steuer absetzen wollte.
#14 Die Folgen des Weinskandals waren großteils
verheerend, von manchen wird er aber auch als notwendig bezeichnet:
*) Weltweiter Zusammenbruch unseres Weinverkaufs,
*) 9 Millionen Euro Warenverlust
*) unbezifferbar hoher weltweiter Imageschaden
*) Ein Selbstmord
*) U.a. zwei achtjährige Haftstrafen
*) Auflösung vieler kleiner Betriebe
*) Erstellung des schärfsten Weingesetzes der Welt
*) Prüfung jedes Weines vor Verkauf
*) Qualitätsquantensprung bei österr. Winzern
*) Gründung der Österreich Wein Marketing
#15 Hochaktuelle & brisante Infos zum Thema Sturm:
Seit heuer gibt es erstmals ein Produkt mit dem Namen „Herbstwind“ im Regal. Herbstwind ist wie Sturm, jedoch nicht von österreichischen Trauben sondern von ausländischen. Wegen dem hohen
Traubenpreis heuer(geringe 2010er Ernte) weigerten sich viele Produzenten diesen zu zahlen und ließen ganze Tankzüge Most importieren, wodurch der Traubenpreis um ca. ein Viertel heruntergedrückt
wurde. Diese Unart könnte nun jedes Jahr passieren. Also bitte zum Sturm greifen und weiter informieren.
Woche 4
#16 Die Schlieren bzw. Kirchenfenster in einem Weinglas nach dem Schwenken kommen vom Glyzeringehalt, welcher in direktem Verhältnis zum Alkoholgehalt steht. Je näher die Schlieren beieinander sind, desto höher beide Werte. Mit viel Kosterfahrung kann man so recht gut den Alkoholwert erschätzen. Glyzerin bildet diese Fenster aufgrund seiner höheren Viskosität(dickflüssiger) und niedrigeren Oberflächenspannung im Vergleich mit Wasser. Zucker und Extrakte könnten den Effekt ebenfalls verstärken.
#17 Die Vorgänger der heutigen Rebpflanzen hatten ausschließlich blaue Trauben. Dass es Weißwein gibt, haben wir einer Mutation zu verdanken - ähnlich wie der bei Albinotiere. Nur fehlte hier der Anthocyan-Farbstoff. Bei manche Sorten kann man das Phänomen noch heute verfolgen: Bei Blauen Burgunder kann es recht einfach passieren, dass einzelne Beeren einer Traube weiß sind. Selten aber noch interessanter: Es kann eine Beere ebenso zur Hälfte weiß, auf der zweiten blau sein.
#18 Die verschiedenen Arten von Süßwein:
*) Spätlese: Trauben bleiben etwas länger hängen, damit das Wasser in den Beeren verdunstet und der Zuckergehalt steigt - süßerer und/oder stärkerer Wein.
*) Beerenauslese: Trauben bleiben wesentlich länger hängen - ein gesunder Pilz(Botrytis) hilft bei der Zuckerkonzentrierung der Beeren
*) Trockenbeerenauslese: Hängt noch länger - sehr sehr edelsüßer Wein
*) Strohwein: Trauben werden normal geerntet und auf Stroh getrocknet
*) Eiswein: Trauben bleiben hängen bis es das erste Mal unter -7 Grad Celsius erreicht, werden gefroren geerntet und gepresst
#19 Wenn Weine mit "Duftspiel nach
Zitrus-Orangen-Nuss", "ausdrucksstarke Frucht nach grünem Paprika-Brennnesseln-Zitronengras" oder "am Gaumen fruchtbetont mit Blutorangen-Zimt-Vanille" beschrieben werden, sind das nicht nur
Worte um ein Genussgefühl aufs Papier zu bringen.
Man kann sogar mit sehr aufwändigen Analyseverfahren dieselben Aromaverbindungen in diesem Wein nachweisen, wie sie in derjenigen Frucht oder dem Gewürz vorkommen, sofern die Beschreibung treffend
ist.
#20 Um den
Reifezeitpunkt und somit optimalen Lesetag von Weintrauben zu bestimmen, gibt es zwischen komplizierte Aussagen, einfache Pi*Daumen-Regeln oder altbewährte Großvater-Gesetze unterschiedlichste
Ansätze.
Aufwendig wäre zum Beispiel diese: Das Zucker/Säure-Verhältnis sollte bei 23:1 und das Weinsäure/Äpfelsäure-Verhältnis über 1 liegen.
Andere meinen, dass exakt 111 Tage nach der Blüte die Trauben in den Keller gehören(In Standardwitterungsjahren total richtig).
Die einfachste, gängigste, schnellste und dabei immer noch richtige Reifebestimmung ist diese: Wenn sich die Kerne der Beeren von grün auf braun verfärben, ist es
soweit.
Woche 5
#21 Für Weißwein presst man die geernteten und angequetschten Beeren sofort und vergärt erst danach.
Um eine Farbe bei Rotwein zu erhalten, muss der Saft länger mit der Beerenhaut, welche den Farbstoff enthält, in Kontakt bleiben. Deswegen wird nach dem Quetschen das "Beerenmus"(Maische) vergoren
und erst danach gepresst.
Würde man die blauen Trauben gleich nach der Lese pressen, würde man weißen Most erhalten, der als Wein dann Blanc de Noir heißt.
Hält man den Saft nur einige Stunden in Kontakt mit den Beerenhäuten und presst dann, ist das Ergebnis der beliebte Rosé.
#22 Auf jeder Flasche Wein ist der Zusatz „enthält Sulfite“ zu finden. Im Weinbau ist der Schwefel ein nahezu
perfektes Wundermittel, wenn es für manche nicht allergisch wäre. Es lässt den Most und Wein nicht braun werden(durch Oxidation), speichert länger Aromen, tötet Bakterien, hemmt ungewollte Hefen,
lässt jedoch den erwünschten Hefestamm am Leben und hält den Wein jahrelang trinkbar. Seit Jahrzehnten wurde an einem Schwefelersatz wie Silberkolloid, Ascorbinsäure, CO2, Velcorin usw. geforscht,
doch keines konnte der Eierlegende-Wollmilchsau Schwefel das Wasser reichen.
Morgen: Warum Schwefel nicht am Kopfweh schuld ist, und wer die Übeltäter sind.
#23 Um vom Schwefel Kopfschmerzen bekommen zu können, müsste man bei den üblichen
Schwefelwerten in den Weinen rund 10 Liter Rotwein oder über 7 Liter Weißwein trinken. Wird schwer.
Hauptauslöser, welche bei weit geringeren Weinmengen Kopfweh verursachen, sind:
*) Fuselöle (schlechte langkettige Alkohole - entstehen bei der Gärung durch unsauberes Traubenmaterial),
*) Acetaldehyd (durch zu hohem Luftkontakt bei der Lagerung im Keller) und
*) Histamine (ist in Rotweinen und sehr schweren Weißen enthalten, entsteht beim BSA).
Also immer zum kompetenten Winzer eures Vertrauen greifen.
Ein ganz heißer Tipp sind da natürlich gleich wir ;)
#24 BSA, was gestern schon vorkam, bedeutet
Biologischer Säure Abbau. Dabei wandeln Bakterien die aggressive und spitze Apfelsäure in die sehr weiche und milde Milchsäure um. Das macht den Wein runder, da die Säure, die zu leichten frischen
Weißweinen besser passt, milder wahrgenommen wird.
Der BSA wird von Winzern mittlerweile bei nahezu allen Rotweinen gemacht und gern auch bei schweren, komplexen Weißweinen, wie Chardonnay, Weißburgunder oder auch bei anderen Sorten in
Reservequalität.
#25 Bevor der Wein
gekostet wird, wird natürlich gerochen. Dabei sollte man jedoch mit der Nase nicht tief einatmen sondern eher leicht schnuppern. Beim tiefen Einatmen zieht man die Aromen nur ganz kurz und zu schnell
an der Riechschleimhaut vorbei und weiter in die Lunge, worin sie der Körper nicht wahrnehmen kann. Kurzes, leichtes Schnuppern hingegen versorgt die Nase länger mit den wunderschönen
Geruchsmolekülen der Weine und ermöglicht somit eine längere und genaue Analyse aller Düfte.
Woche 6
#26 Eine Bewegung, welche jeder Mensch besser drauf haben sollte, als der Wiener Walzer ist der Weinglas-Sechser. Denn man weiß ja nie, wann man unerwartet einen Wein in die Hand gedrückt bekommt. Die 6er-Drehung mit der Hand kann man zu Beginn am leichtesten auf einem Tisch üben. Man zeichnet von der Vogelperspektive aus gesehen mit dem Weinglas einen faustgroßen 6er auf den Tisch, dem jedoch, bevor er zuende gezeichnet wurde, ein fingernagelkleiner mini 6er an das Ende angehängt wird. Hat man die Drehung am Trockentrainingstisch in etwa heraus, übt man sie in der Luft, bis man getrost sogar vorm Chef gekonnt schwingen kann. Immerhin zählt Wein als Stilobjekt und der gelungene Umgang damit beweist ein gewisses Kulturniveau. So, let’s swing.
#28 Das Weinaroma, das man im Mund schmeckt, wird eigentlich gerochen, da man ja nur süß, sauer, salzig, bitter und umami schmecken kann. Durch die Körperwärme im
Mund werden im Wein die schweren, langkettigen Aromen gelöst. Diese "riecht" man dann über die im Rachenraum befindliche Verbindung zur Nase.
Genannt wird dies retronasale Wahrnehmung und die Wichtigkeit davon merkt man bei einem Schnupfen, wenn diese Verbindung geschlossen ist und man nichts mehr "schmeckt".#27 Das Barriquefass, welches aus Eichenholz besteht und meist 225 Liter fasst(selten bis zu 700 Liter) schenkt einem Rotwein oder manchmal auch einen schweren hochwertigen
Weißwein verschiedene Geschmacks- und Geruchsnoten, welche von Karamell-, Rauch-, Holz- über Vanilletönen reicht und vom Toastinggrad des Fasses und der Lagerdauer darin abhängt. Bei der Produktion
wird ein Barriquefass innen tatsächlich mit Feuer braun gebrannt und die Intensität davon wird Light-, Medium- oder Heavy-Toasting genannt.
Das Wort Barrikade stammt übrigens ebenfalls von den Fässern, welche im 19. Jhdt mit Erde befüllt als Straßensperre dienten.
#29 Der Böckser ist einer der bekanntesten und häufigsten Weinfehler. Wenn er deutlich ausgeprägt ist, riecht er sehr unangenehm nach faulen Eiern, Knoblauch oder auch Zwiebeln. Man kann bei Verdacht auf einen Böckser einen uralten Kellermeistertrick anwenden: Man wirft in den Wein eine „kupferne“ Münze(unter 5 Cent) und schwenkt. Das Kupfer der Münze wird durch die Weinsäure gelöst und bindet sich mit der Böckserverbindung H2S, sodass es nicht mehr gerochen werden kann. Wenn nach dem Münzwurf der mutmaßliche Böckser verschwindet, gab es ihn. Wenn nicht, ist es ein anderer Weinfehler.
#30 Wenn ein Wein einen Korkfehler hat, riecht er nicht direkt nach dem Kork, sondern nach dem Schimmelpilz, der sich bei zu feuchter Lagerung der Korkplatten(noch
beim Korkhersteller) bildet. Diese Platten sind eigentlich die Rinde eines bestimmten Baumes und werden nach einigen Jahrzehnten vom Baum heruntergebrochen. Danach werden diese getrocknet und daraus
die Korken mit ihrer typischen Form herausgestanzt. Und bei dieser Trocknung darf kein cm feucht bleiben, sonst setzt der Pilz später die Korkfehler-Leitsubstanz "Trichloranisol" frei.
Falls man beim Weinkosten unsicher ist, ob er korkt oder nicht, einfach mit Mineralwasser spritzen – dieses verstärkt den Korkton.
Woche 7
#31 Die Form und das Grunddesign eines heutigen Weinglases ist mittlerweile für jedermann selbstverständlich und alltäglich. Hier der Hintergrund, warum es so
aussieht:
Dass man das Weinglas an einem langen Stiel hält, kommt davon, dass man so den Wein mit der Körperwärme nicht erwärmen kann. Darum ist es auch so verpönt ein Weinglas
am Bauch zu halten.
Der Bauch selbst hat diese Form, damit beim Schwenken dem Wein die größtmögliche Kontaktoberfläche zur Luft gegeben wird und
sich somit genug Wein verdunsten und Aromen verflüchtigen können. Damit sich diese Aromen konzentrieren, wird das Glas oben enger und wirkt wie ein Aromatrichter für die Nase.
Da der Wein und somit das Gewicht wegen des hohen Stiels sehr hoch oben und so der Schwerpunkt extrem schlecht verteilt ist, braucht man für die trotzdem benötigte Stabilität den flachen und sehr
breiten Boden. Morgen: Unterschiede zu Weißwein-, Rotwein- und Sektgläser.
#32 Rotweingläser haben naturgemäß einen wesentlich größeren Bauch als Weißweingläser, da Rotwein viel mehr Luft benötigt um die
Tannine(welche bei Weiße wenig Rolle spielen) samtiger werden zu lassen. Es gilt hier: je schwerer und komplexer der Rotwein, desto größer der Bauch. Bei fruchtigen, leichten Weinen nimmt man Gläser
welche nur wenig größer als Weißweingläser sind. Bei schweren Bordeauxweinen kommt schon mal ein Bauchdurchmesser von über 10cm auf den Tisch.
Die typischen Sektflöten haben ihre hohe zylinder-ähnliche hohe Form, damit die schönen Kohlensäureperlen den längstmöglichen Weg hinlegen und der Sekt die geringstmögliche Oberfläche hat, um
Kohlensäure entweichen zu lassen. Viele Sektgläser haben innen in der Mitte eine kleine Einritzung, damit sich die Kohlensäure an einem vorbestimmten Punkt bildet und somit als schöne Kettenform
empor steigt.
#33 Da hochwertige Rotweine vor allem im späteren Alter und somit höherer Reife ein Depot bilden, welches aus Farb- und Gerbstoffflöckchen besteht, müssen diese mit
einem Dekanter vom Wein getrennt werden. Der Wein wird in das unten extrem bauchige und oben sehr eng verjüngende Gefäß hineingeschüttet und sammelt sich relativ schnell am Boden. Beim Einschenken
wird stets immer nur Wein aus dem oberen Bereich in das Glas gebracht und die Ablagerungen sammeln sich in der Kante des Bauches, sodass einem klaren Weinvergnügen nichts mehr im Wege
steht.
Morgen: Funktion der Karaffe und der Unterschied zum Dekanter
#34 Junge, noch zu wenig gereifte Rotweine sollten vor dem Trinken in einer Karaffe belüftet werden. Das hat den Hintergrund, dass der noch sehr gerbstoffhältige und
tanninreiche Wein mit genügend Sauerstoff versetzt wird und diese somit samtiger und trinkfreundlicher werden. Statt dem pelzigen Gefühl auf der Zunge wirken sie danach weich wie Samt. Deswegen sind
Karaffen auch so gebaut, dass möglichst viel Luft zum Wein kommt – im Gegensatz zum sehr engen Hals beim Dekanter.
Ein Dekanter gehört also rein zum Trennen des Weins vor dem Depot. Jedoch wird beides gern zweckentfremdet und auch gern für die jeweilige andere Funktion benutzt. Die Vorgänge nennt man dann
übrigens „karaffieren“ und „dekantieren“ – was fälschlicherweise sehr gern verwechselt wird.
Woche 8 (ab jetzt nur mehr montags und donnerstags)
#35 Das Aroma eines Weines besteht aus den vier Aromakategorien Primär-, Sekundär-, Tertiär- und Quartiär-Aroma.
Das Primäraroma ist meist das wichtigste und interessanteste und stammt von den Trauben im Weingarten. Es erzeugt die sortenreine und authentische Duftnote(Marille,
Holunderblüte, Paprika, Grüner Apfel, Banane, Rosenblüten)
Das Sekundäraroma entsteht während der Gärung durch die Hefe und kann bestenfalls einige fruchtige, süßliche oder brotige Aromen
„herauskitzeln“, spielt oft jedoch eine kleinere Rolle(Eisdrops, Exotik, Biskuitnote)
Das Tertiäraroma wird durch die Lagerung z.B. im Barriquefass verabreicht(Rauchnoten, Vanille, Kokos, Karamell)
Das Quartiäraroma entsteht mit der Alterung eines Weines(Petrolnote, Sherryton, Tabak, Lakritz).
#36 Warum färben sich die Rebblätter im Herbst rot oder gelb?
Die Farbe eines Blattes bestimmt das Farbstoffverhältnis darin, welches bei jeder Pflanze variiert. Bei den vielen Pflanzen besteht es aus über 85% grün(Chlorophyll), 10% gelb(Carotinoide) und 5%
rot(Anthozyane).
Da im Herbst die Tage kürzer werden, weiß die Pflanze, dass sie für den Winter Stoffe aus den Blättern in die Wurzeln lagern muss, um für den Frühling ausreichend
gestärkt zu sein. Sie baut zuerst den grünen Farbstoff ab und verändert dadurch das Farbstoffverhältnis, bis sich die nächststärkere Farbe durchsetzt(oder ein Farbgemisch).
Hat die Sorte mehr rote Farbstoffe, als gelbe, werden auch die Blätter davon im Herbst rot.
Bei recht gleichem Verhältnis zwischen gelb/rot werden sie orange.
Meist jedoch überwiegt der gelbe Anteil, sobald der grüne abgebaut wurde.
Woche 9
#37 Der Schraubverschluss wird mittlerweile bei fast jeder Weißweinflasche eingesetzt, bei Roten seltener. Das hat den Grund, da Weißweine im besten Fall nicht
altern und reifen sollen, damit sie frisch und fruchtig bleiben. Rotweine tut eine Reifung sehr gut, da dadurch Gerbstoffe und Tannine weicher werden und der Wein harmonischer wird.
Die Alterungs-Geschwindigkeit von Weinen bestimmt großteils der Luftkontakt(aber auch UV-Lichteinwirkung) zum Wein.
Da der Schraubverschluss einer der dichtesten und trotzdem edlen Verschlüsse ist, ist so sein Siegeszug bei Weißwein und seine Daseinsberechtigung ohne Weinabwertung erklärt.
Der Kork lässt optimal sehr wenig aber konstant Luft hindurch und Rotweine so ideal über die Jahre langsam aber doch reifen.
#38 Ursprünge und Hintergründe zu weißen Sortennamen:
Der Name des Grünen Veltliners und Traminers stammt von den Südtiroler Orten Veltlin und Tramin ab.
Bei Chardonnay gibt’s ebenfalls einen gleichnamigen Ort in Frankreich.
Alle Muskateller-Variationen wurden nach dem Aroma der Muskatbaumfrucht/-nuss benannt.
Sauvignon stammt vom französischen „savage“ ab und steht für „wild, unkultiviert“
Der Ursprung des Wortes Riesling, von dem sich einige Sorten ableiten, ist eigentlich unbekannt. Nach ewigem Suchen fand ich aber 3 Theorien:
1.) Es könnte von Rissling abstammen – wegen dem Aufreißen des Rebholzes im späteren Alter,
2.) Um 1500 wurde er Russling genannt, möglicherweise nach der schwarzen Farbe des Rebholzes(wie Ruß) oder
3.) vom Verrieseln und der Tendenz der Sorte dazu(Vorzeitiges Abfallen der Blütenblätter im Frühling und somit keine Beerenentwicklung)
Woche 10
#39 Namenshintergründe zu roten Rebsorten - Teil 1
Zweigelt: Der Rebzüchter und späterer Direktor Friedrich Zweigelt aus Klosterneuburg züchtete 1922 diese Kreuzung und nannte sie Rotburger. 1975 wurde sie unter anderem
durch Lenz Moster bei der Qualitätsweinverordnung in Zweigelt umbenannt.
Merlot: stammt vom französischen Wort „merle“ für Amsel ab und ist eine Anspielung auf die Farbe aber auch auf die Vorliebe der
Vögel zur Sorte
Blauer Portugieser: wurde angeblich 1772 von Porto nach Bad Vöslau gebracht, wurde aber in Portugal nie angebaut und dürfte nur eine Sage sein. Wahrscheinlichster Züchtungsursprung ist in Österreich
selbst.
St. Laurent: Kommt wider erwarten nicht von der franz. Gemeinde „Saint Laurent“, sondern von der ersten Essreife der Beeren am Laurenzitag(10. Aug)
#40 Teil 2 der Rotwein-Namensursprünge:
Blaufränkisch: Napoleons Truppen wurden mit blauen & roten Francs als Währung bezahlt. Während ihres ungarischen Aufenthalts hatten sie einen absoluten
Lieblingsrotwein und tranken nur diesen. Da die roten Francs nahezu wertlos waren, ließen sich die Bauern sehr bald nur mehr mit blauen Francs dafür bezahlen – also mit kék Frankos, übersetzt:
Blaufränkisch.
Der deutsche Ausdruck für Blaufränkisch ist Lemberger und dies kommt vom NÖ-Ort Limberg, welcher heute Maissau heißt.
Pinot: kommt von Pineau/Pin/Pine, da die Traubenform einer Ananas ähnlich sei.
Cabernet S/F: nicht genau bekannt, wahrscheinlichste Theorie der Sprachforscher ist die Ableitung von Carbonat(Kohlenstoff) aufgrund der Assoziation mit kohlschwarzer Farbe.
Woche 11
#41 Weinstein ist ein Salzkristall, welcher sich aus der Weinsäure bildet. Bei seiner Entstehung, wird somit der Weinsäure- und Gesamtsäuregehalt verringert. Je tiefer die Temperatur, desto leichter kann sich Weinstein bilden(meist bei weniger als 2°C), vor allem wenn der Wein davor nicht weinsteinstabil gemacht wurde. Würde man den Weinstein zu einem Pulver vermahlen und mit Natron vermischen, erhielte man ein natürliches Backpulver, welches wie das herkömmliche, aber chemisch hergestellte, anwendbar ist.
#42 optimale Trinktemperaturen von verschiedenen Weintypen
leichte Weißweine & Rosés: 7-10°C
schwere Weißweine: 9-13°C
leichte Rotweine: 13-16°C
schwere Rotweine: 16-19°C
Süßweine: 10-16°C
Sekte: 6-8°C
Generell gilt: je komplexere & qualitativ hochwertiger der Wein ist, desto höhere Trinktemperaturen verträgt er. Dadurch werden wesentlich mehr Aromen freigesetzt, jedoch auch Fehltöne, welche
bei leichten & einfacheren Weinen mit den tieferen Temperaturen unterdrückt bleiben.
Woche 12
#43 Weinbau vor dem Jahre Null:
~5000 v.Chr. - Erste Nutzung durch den Menschen
~3500 v.Chr. - Im alten Ägypten wurden schon Weinreben in Weinbergen mit Holz gestützt, Trauben gestampft, mit Tüchern gepresst und filtriert, in Tonkrügen vergärt und die Folgen des Weingenusses dokumentiert.
~1700 v.Chr. - Weinbergsfrevel wird gleichgestellt mit Mord und Tempelraub
~750 v.Chr. - die ersten Traubenkerne wurden ins heutige Burgenlandgebiet gebracht und angebaut
~15 v.Chr. - Weinbau in Städten wie Carnuntum, Vindobona, Aquae(Baden), Augustiana(Traismauer), Favianis(Mautern), Neusiedler See, Eisenberg oder Steiermark
#44 Tresterbrand und seine Erzeugung: Den Überrest aus der Weinpresse nennt man Tresterkuchen. Nimmt man diese trockene bis halbtrockene Masse und gibt Wasser und etwas Zucker hinzu, kann
man Sie ebenfalls zu einem „Wein“ vergären. Dieses Zwischenprodukt mit den aus dem Trester versetzten Aromen kann man anschließend in einem Brennkessel destillieren, sodass der Alkohol bei 78°C mit
seinen gebundenen Aromen vor dem Wasser verdunstet und sich dieser „Alkoholdampf“ nach der Abkühlung wieder konzentriert verflüssigt. Diesen Brennvorgang kann
man einige Male wiederholen, um wesentlich bessere Qualitäten zu erhalten.
Nebeninfo: Steht man länger im Raum beim Brennkessel, kann man alleine von den Dämpfen "betrunken" werden.
Woche 13
#45 Es gibt 3 Arten wie die feine Kohlensäure in den Sekt kommen kann.
1. Durch Zugabe von Kohlensäure bei der Flaschenfüllung. Dabei wird flüssige Kohlensäure kurz bevor der Wein in die Flasche gefüllt wird zugesetzt und sofort zugekorkt, damit nichts entweichen
kann.
2. Durch eine Gärung in einem Überdrucktank, sodass die Kohlensäure, welche bei der Zucker-Alkohol Umwandlung als Nebenprodukt entsteht, nicht entweicht
sondern sich flüssig im Wein bindet.
3. Durch eine zweite Gärung in der Flasche(Champagnermethode). Der fertige Wein wird in die Flasche gefüllt und mit etwas Most und einer neuen Hefe versetzt. Nach dem Verkorken fängt der Wein noch
einmal an zu Gären und die Kohlensäure bleibt wie beim Übertank im Wein. Da die tote Hefe danach noch in der Flasche ist und nicht gut schmeckt, muss sie vor dem Verkauf entfernt werden. Wie diese
aus der Flasche kommt und warum "Handgerüttelt" bei Sekt zu 98% ein Marketingschmäh ist, wird am Donnerstag erklärt.
#46 Nach der Sekt-Flaschengärung ist noch die tote Hefe in der Flasche. Und hier kommt das berühmte "Handrütteln" ins Spiel. Die Flasche wird über Wochen
jeden Tag sehr langsam von der waagrechten, liegenden Position in die senkrechte, auf den Kopf stehende, Position gerüttelt, sodass nach und nach die tote Hefe in den Flaschenhals rutscht. Früher
machte man dies per Hand und wird bei geringen Produktionsmengen immer noch so gemacht. Große Sektkellereien nutzen aber schon sehr lange maschinelle
Rüttelmaschinen, da das händische Rütteln zu hohe Kosten verursacht würde. Angeworben und sogar bei Führungen in einem Schau-Rüttelkeller trotzdem noch gerne erzählt, dass alles handgerüttelt wird.
Hier darf man gerne noch einmal ganz genau nachfragen, wie viele Rüttelarbeiter die Kellerei hat, um die Millionenproduktionen durchzurütteln. ;)
Wenn sich die tote Hefe dann im Flaschenhals gesammelt hat, wird dieser in eine -20°C Kühlsole getaucht, sodass die Hefe gefriert. Öffnet man jetzt die Flasche, schießt der gefrorene Hefe-Pfropfen
heraus und man kann den Sekt mit der immer betriebsgeheimen Dosage(Most-Weingemisch) auffüllen und verfeinern. Verkorken und fertig ist der Sekt.
Woche 14
#47 Um eine neue Rebsorte erzeugen zu können, muss man zwei verschiedene Weinsorten kreuzen. Da die Weinrebe jedoch ein Zwitter bzw. ein Selbstbestäuber ist und beide Geschlechtsorgane aufweist, muss man bei der gewünschten Mutterpflanze die männlichen Organe, also den Blütenstaub entfernen. Die restlichen Blüten der Mutterpflanze werden mit dem zuvor gesammelten Blütenstaub der gewünschten Vaterpflanze befruchtet und aus den daraus wachsenden Trauben und deren Traubenkernen entsteht eine neue Rebsorte mit bunt gemischten Genen der Vater- und Mutterpflanze. Warum jedoch nicht jedes Jahr eine Unzahl an neuen Sorten erzeugt werden und wie extrem aufwändig das Selektionsverfahren bei der Rebzucht ist, wird am Donnerstag erklärt.
#48 Wie der Mensch hat jede Pflanze ebenfalls eine DNA in dem der genetische Code sitzt. Kreuzt man nun zwei Sorten können quasi unendlich viele Kombinationen
aus den Eigenschaften der Eltern entstehen und die unterschiedlichsten Qualitäten in allen Bereichen aufweisen. Da die heute etablierten Rebsorten (z.B. Grüne Veltliner) jahrhundertlang bis zur
Perfektion gezüchtet und geklont wurden, ist es äußerst schwer, eine Rebsorte zu züchten, die auch nur annähernd gute Eigenschaften besitzt. Würde man heute
beginnen zu züchten, müsste man tausende Neuzüchtungen aussetzen, diese danach Jahr für Jahr kontrollieren, die schlechten ausschließen und die besseren weitervermehren. Diese Pflanzen und deren
Weine werden über das ganze Jahr genau auf Herz und Nieren geprüft und protokolliert, bis man mit sehr, sehr viel Glück eine Rebsorte gefunden hat, die in mehreren Bereichen gute Ergebnisse
hervorbringt. Das ganze dauert etwa 10-15 Jahre. Will man seine neue Sorte registrieren lassen, damit Winzer sie anbauen dürfen, wird sie vom Staat nochmals ca. 10 Jahre lang geprüft und eventuell
genehmigt. Aktuell ist eine neue Sorte der Rieslingfamilie kurz vor der Genehmigung: der Donauriesling.
Woche 15
#49 In den letzten Wochen hat die Rebe den Wassergehalt der Zellen vermindert und Stoffe darin eingelagert, um sich vor den winterlichen Frost zu schützen. Würde es einen extrem schnellen Wintereinbruch geben, würde die Pflanze auch bei wesentlich höheren Temperaturen Schaden davontragen. Bei einem normalen Herbst verträgt sie abhängig von der Sorte zwischen -17°C und -25°C. Gäbe es tiefere Temperaturen müsste man die Rebe mit einer Frostschutzberegnung schützen. Dabei spritzt man bei Minusgraden mit Wasser dauerhaft eine Eisschicht über die Pflanze, da darunter die Temperatur konstant bei etwa -1°C gehalten wird, selbst bei Außentemperaturen von -40°C.
#50 Weinbegleitung für Weihnachtsessen:
Zur typischsten aller Weihnachtsspeisen zählt in Österreich der Karpfen: Hier empfiehlt sich ein sehr schwerer und trockener Weißwein, er verträgt jedoch auch alle trockenen Arten von
Rotwein.
Wird Lachs serviert, passt ein mittelschwerer Weißer oder ein toller Rosé perfekt.
Bei anderen Fischen wäre man mit leichten bis mittelschweren Weißen optimal vorbereitet.
Ente, Gans, Truthahn oder Fasan vertragen auch mittelschwere bis schwere Rotweine, vor allem wenn Rotkraut als Beilage serviert wird.
Zu den ebenfalls gerne vorbereiteten Belegten Brötchen punktet man mit einem mittelschweren Riesling, der toll die Käse- und Schinkenauflagen abrundet. Wird mit Schweins- oder Kümmelbraten belegt,
kann gerne auch ein leichter Roter dazu getrunken werden.
Bei süßen Speisen passt natürlich ein Süßwein bestens.